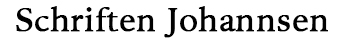Sonderausstellung „Ancien Regime neu gesehen“,
Saal 5: „Moliere und sein Umfeld“
„Lassen Sie uns vor diesem Bild ein wenig verweilen. Hier sind sie eigentlich alle versammelt, die Helden der Feder, die Unsterblichen des Pantheon … Aber ich wollte Sie ja zu Wort kommen lassen! Was sehen Sie hier? Was hat Monsieur Monsiau, das ist kein jeux de mots, so hiesz der Maler, geboren 1754 in Paris, hier dargestellt?“ Schon als Dr. Berthold Kugelmeier es aussprach, wuszte er: Fehler. So kriege ich die nicht zum Reden. Abholen, Anknüpfen, Amüsieren, das war gefragt. Und er muszte sich doch irgendwann einmal eingestehen, dasz das nicht zu seinen Kernkompetenzen gehörte. Aber absolut zum Anforderungsprofil für Kunst-vermittlerInnen.
Jetzt: aushalten. Die Stille aushalten. Einen entspannten Eindruck vermitteln, auf Körpersprache achten.
Achja, die Maxime seines verblichenen Kollegen Stilke war: in den ersten Minuten checken, wer der Anführer einer Gruppe war, der Leader, der mit dem gröszten Ego. Und sich dann an den wenden. Stilke war der King der Hauptschulklassen, der Oberdompteur der Pubertiere.
Sagenhaft, wie der Stille herzustellen wuszte. Unter seiner Hand wurde aus der Stille ein sagenhafter Stoff, eine Zuckerwatte der Verheiszung.
Dies geschah in diesem Kunstmuseum, in dem Dr. Kugelmeier sich bald 30 Jahren etwas dazuverdiente. Zum Glück wurde er vor 30 Jahren von einer ehemals attraktiven Studienrätin geheiratet, die sich in einen jungen wilden Künstler verliebt hatte, den Kugelmeier einst gut darstellen konnte.
Von der Süsze der wattigen weiszen Stille unterschied sich die gegenwärtige. Sie schien vernutzt und wies Schleifspuren auf.
Kugelmeier hielt jetzt um 13:30 Uhr diese Stille nicht mehr aus und er wandte sich an eine junge Dame mit Giacometti-Figur und Amy-Winehouse-Frisur: „Was ist hier dargestellt, geben Sie uns doch bitte drei Details!“
Perfekte Ton-Bild-Schere. Die Angesprochene schaute durch ihn, Kugelmeier, hindurch, schien allgemein Anwesende zu ignorieren und sprach klar artikuliert und in einem süddeutschen Singsang: „Dargestellt ist eine Gruppe von Männern mit Lockenperücken, bestickten Jacken, Kniebundhosen, Strumpfhosen und Schnallenschuhen. Genügt das?“
„Äh, ja, Danke, erstmal …“ Kugelmeier deutete eine Verbeugung an und wünschte sich fort an einen anderen Ort. „Sehr schön. Bildbeschreibung Teil 2, der Aufbau.“ Ein Junge im Gothic Style mit Schnallen-Schmuck erbarmte sich: „Na, sieht man doch: Die Männer sitzend oder stehend, irgendwie aufgeregt, im Zentrum ein roter Tisch und davor einer stehend in prächtigem grünen Anzug mit ganz vielen Knöpfen und Schallaballa – Spitzen hängen ihm aus den Ärmeln und beide Arme hält er hoch.“ Vereinzeltes Gekicher in der Gruppe. „Nein, so nicht. In der Einen hat er ein zerfleddertes Buch.“
„Sehr schön, genau. Und was fällt Ihnen sonst noch auf?“
„Der Typ geht durch den Raum, Fuszballerwaden, paszt nicht … er ist irgendwie on stage, Leute im Raum applaudieren, ihm, Star …“
„Ja, danke, das haben Sie schön gesehen und gesagt. Sie sprechen von „Leuten“ im Raum – wie verhält sich das?“
Kugelmeier sprach, kühn geworden, eine Frau an, die der Kollege Stilke sicher als „Mauerblümchen“ bezeichnet hätte, zweite Reihe hinten links.
Das Mauerblümchen wuchs eine Hauptlänge in die Höhe und es fragt: „Was stimmt mit Euch nicht? Da sitzen 18 Männer, wahrscheinlich 17. Jahrhundert, und im Zentrum des Gemäldes und mitten im Licht eine Frau.“ Kugelmann: „Ist sie nicht eigentlich Star der Szenerie? Womit ist sie gekennzeichnet?“
Die SchülerInnen schienen verstanden zu haben, dasz es ohne Mitarbeit niemals vorbei wäre. Und es entstand vor ihren Augen eine hübsche junge Frau mit blonden Stirnlöckchen, die linke Hand lebhaft im Raum, die Andere hält eine Rose und ruht zwischen ihren Oberschenkeln. Das hellblaue Kleid glänzt seidig. Wir sehen viel Decolté und eine kleine Perlenkette.
Noch ein Beitrag von hinten rechts: „… und zu ihren Füszen auf einem Samtkissen posiert ein langschnäuziger Hund.“ Wo schaut der hin? Auch zum Vortragsstar, das war inzwischen klar, in grün mit dem komischen Spitzen-Halsteil.
Und die Blicke sonst? Die beiden Nachbarn von Madame wenden sich Madame zu, ihre Blicke aber schweifen vor ihr, treffen sich etwa einen Meter vor ihrem Gesicht, es scheint die Dame nicht zu tangieren.
Kugelmeier stellte sich vor die Tafel mit Bildtitel und Erklärungen. Er war schlieszlich das Medium. „Frage an Sie: haben Sie diese Informationen gebraucht zum Lesen des Bildes? Ich gebe sie Ihnen jetzt und bitte Sie um Beantwortung im nächsten Raum. Gemalt 1802, eine Szene darstellend von 1664. Titel: Moliere liest aus dem „Tartuffe“ im Salon der Ninon de Lenclos. Und zu den Zuhörern gehören quasi die gröszten französischen Schriftsteller der Epoche. Gut erkennbar: Racine, Jean de la Fontaine, Corneille. Schauplatz: der Salon der Mademoiselle – so nannte sie sich – Ninon de Lenclos.“
Es näherte sich eine weitere Besuchergruppe, angeführt von einer jungen Frau mit bunten Haaren, die, so Kugelmeiers flüchtiger Gedanke, hoffentlich an der Kasse eine Lizenzgebühr bezahlt hatte.
Kugelmeier bedeutete seiner Gruppe, ihm zu folgen. Daher verpassen wir jetzt die Antworten von SchülerInnenseite.
Die Gruppe, die sich jetzt nachflosz und den Raum gut füllte, hatte mehrere SprecherInnen.
„Hallo ich bin Toni vom Seminar „Selbstentwürfe weiblich und weisz gelesener Personen in den europäischen Kolonial-Metropolen des 17. und 18. Jahrhunderts.“
„Ich auch, also ich bin auch aus Tonis Seminar, ich bin Alex. Ich hatte die Aufgabe, die Biographie der weiblichen Gestalt zu recherchieren – hier im Zentrum des Gemäldes, auf dem der Dichter Molière aus seinem neuen Theaterstück über einen religiösen Hochstapler-Frömmler, den „Tartuffe“ vorliest. Es ist das Haus der Ninon de Lenclos. Das findet in Ihrem Haus, in ihrem Salon statt.“
„Hey, echt jetzt: „Es darf nur eine geben“, was? Da fällt mir sofort Kebekus Buch ein mit diesem Titel … Kennt Ihr? Hat Ninon nur Männer eingeladen? War die so drauf?“ Notiz ins Smartfohn: in der nächsten Sitzung den unbelesenen eine kleine Einführung in Literatur geben.
„Das kann ich Euch nicht sagen. Erste Recherche zu Ninon: Salondame, Intellektuelle, Kurtisane – Zusatz: die berühmteste Kurtisane des 17. Jahrhunderts.“ Alex muszte sich eine Unterbrechung gefallen lassen.
„Erklärungsbedürftig: KURTISANE.“ Die Kritikerin schaute sich beifallheischend um.
„Klar. Ein altes Wort für eine gehobene Prostituierte, kommt von Hof, Königshof. Italienisch, Cortigiana.“ Alex schien sprachverliebt.
„Sag doch Sexarbeiterin, das ist doch der korrekte Ausdruck!“ Da war eine streng.
„Ja, Chris, sicher. Aber da gibt es doch einfach ganz grosze Unterschiede, damals wie heute. Laszt mich kurz von ihrem Leben, oder besser: ihren ganz verschiedenen Leben erzählen, die diese Ninon de Lenclos führte, geboren vor 405 Jahren, gestorben vor 320 Jahren.“
Auftritt kahlköpfiger Mann in blauem Uniform-Anzug: „Herrschaften, so geht das nicht – nein, jetzt rede ich. Sie können hier nicht einfach eine Privatveranstaltung abhalten, besonders nicht in dieser Lautstärke …“
Der Museumsaufsichtsmann sprach noch lange und laut und das führte dazu, dasz das Seminar sich in einem Halbkreis vor dem Gemälde mit den Perücken-tragenden, farbenfroh gekleideten Herren und der einen Dame mit Décolté und Rose versammelte und das Gespräch im Flüsterton fortsetzte. Hinter der Gesellschaft des 17. Jahrhunderts hing ein groszes Gemälde, leider nach-gedunkelt oder aus künstlerischen Gründen blieb das Motiv im Dunkeln. Von links fiel Licht auf die Gesellschaft. Alex flüsterte: „Ninon war zwar adlig, nachdem ihr Vater aber in Zusammenhang mit einem Mordkomplett verurteilt wurde und aus Frankreich floh, wuchs sie bei ihrer Mutter mittellos auf. Doch sie erhielt eine solide Ausbildung – bzw. Bildung. Sie sprach mehrere Sprachen und kannte die Literatur ihrer Zeit. Sie wohnten im Marais – ihre Nachbarin wird Ninons beste Freundin. Sie ist Kurtisane. Marianne und Ninon werden berühmt als zwei It-Girls. Kardinal Richelieu ist erst Mariannes, dann Ninons Lover, oder Sugar Daddy – jedenfalls ist er groszzügig und zahlt ihr eine Apanage – eine Art Leibrente. Mit 19 läszt Ninon sich von vielen mächtigen Männern finanzieren. Prinzen, Grafen, Ritter. Sie teilt ihre Liebhaber in drei Kategorien ein: erstens die Zahler/ die Payeurs. Zweitens die Martyrs/ die Märtyrer – also die in sie Verliebten, die ihr Verfallenen. (Die hielt sie auf Abstand.) Drittens die Favoris, die Favoriten, auch Launen genannt. Ihre Lieblinge. Der verheiratete Marquis de Villarceaux, ich konnte nicht finden, in welche Kategorie er fiel, richtete ihr ein Palais ein gegenüber von seinem.“
Auch das Gelächter der Gruppe war ein Flüster-Lachen.
Dann ereignet sich in Frankreich so eine Art Zeitenwende, eine geistig-moralische. Die neue Habsburgische Königin schwang offenbar einen tugend-Besen – sie veranlaszte die Entfernung der berühmten Kurtisane und ihre Verbringung in ein Kloster. Begründung: ihr Lebenswandel sei eine Beleidigung für die Königin. Das können wir so sehen: denn Marie Therèse wurde sehr streng und religiös im gegenreformatorischen Sinn erzogen. Ihre Ausbildung war relativ bescheiden. Die unglückliche Königin, die übrigens nicht Französisch gelernt hatte, musz sich die Mätressenwirtschaft ihres Louis, uns bekannt als Ludwig der Vierzehnte angucken.
Die Dame de Lenclos, die sich selbst einen Platz in der Oberschicht erarbeitet hatte, einen fragilen, wurde also in eine „Besserungsanstalt für Lasterhafte“ verbracht. Mit Kerker, Zwangsjacke, Essensentzug. Verbringung in ein anderes Kloster weitab von Paris. Und da nun wünscht die abgedankte queere schwedische Königin Christine, wir haben letztens von ihr gehört, sie zu sehen. Wg. der „beauté de son esprit“, der Schönheit ihres Geistes. Die Königin, übrigens konvertierte Katholikin, bewirkt die Freilassung des Freigeistes Ninon.“
Flüstereinwand: „Ich wünschte, es gäbe ein Gemälde der Szene!“ Zustimmungsgemurmel.
„Wieder in Freiheit kauft sie ein Haus in der Rue de Tournelle und wird „Salonière“. Jeden Tag empfing sie Gäste. Achja, das war 1657. Es ist bekannt, dasz Molière sie um Rat frug.“ Alex gab auch die Quelle an, eine allerdings im anekdotischen Ton gehaltene Biographie aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Alles online. An der Authentizität der Briefe der Mademoiselle de Lenclos bestünden Zweifel – darüber wollte Alex dann gern mit den Kommiliton*innen diskutieren.
Doch jetzt läd Alex alle ein: „Schauen wir jetzt noch mal auf die Hand in ihrem Schosz – sie hält eine erblühte helle Rose. Was verbindet Ihr damit?“
Und es wurde plötzlich ganz still im Saal 5 des Kunstmuseums und es war eine schöne Stille.
Wiebke Johannsen
Wolfenbüttel und Hamburch, Februar °25
Seminar Felicitas Hoppe und daheim am Venushügel